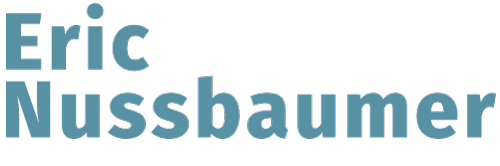Island wird im Jahre 2027 ein Referendum über den EU-Beitritt abhalten. Kommt die Schweiz mit dem im letzten Jahr verhandelten EU-Abkommenspaket im Jahre 2028 zu spät? Meine Gründe für eine Referendums-Abstimmung im Herbst 2026.
 Die Ausgangslage bei den EFTA-Staaten ist klar. Die neue Regierung in Island hat angekündigt, dass sie spätestens im Jahre 2027 ein Referendum zum EU-Beitritt abhalten wird. Die Zustimmungswerte für einen EU-Beitritt wachsen schnell. Das hat vor allem mit den sicherheitspolitischen Entwicklungen zu tun. Die Insel ist NATO-Mitglied, nicht aber EU-Mitglied. Es hat aber auch mit dem Status des EWR und der EFTA zu tun. Zwar hat Island mit dem EWR-Vertrag eine stabile Regelung zur Teilnahme am EU-Binnenmarkt, aber die geopolitischen Veränderungen und die beschränkten Mitgestaltungsmöglichkeiten im EWR führen zu einer grösseren Akzeptanz für eine stärkere europäische Integration. Wenn Island in zwei Jahren für einen EU-Beitritt votiert, wankt auch die EFTA, die europäische Freihandelsassoziation und der EWR. Island könnte bei einem Beitritt auch die europäische Fischereipolitik beeinflussen ( UK ist ja weg…) und das wiederum gefällt Norwegen nicht, die sich dann verlassen in der EFTA/EWR wiederfinden würden.
Die Ausgangslage bei den EFTA-Staaten ist klar. Die neue Regierung in Island hat angekündigt, dass sie spätestens im Jahre 2027 ein Referendum zum EU-Beitritt abhalten wird. Die Zustimmungswerte für einen EU-Beitritt wachsen schnell. Das hat vor allem mit den sicherheitspolitischen Entwicklungen zu tun. Die Insel ist NATO-Mitglied, nicht aber EU-Mitglied. Es hat aber auch mit dem Status des EWR und der EFTA zu tun. Zwar hat Island mit dem EWR-Vertrag eine stabile Regelung zur Teilnahme am EU-Binnenmarkt, aber die geopolitischen Veränderungen und die beschränkten Mitgestaltungsmöglichkeiten im EWR führen zu einer grösseren Akzeptanz für eine stärkere europäische Integration. Wenn Island in zwei Jahren für einen EU-Beitritt votiert, wankt auch die EFTA, die europäische Freihandelsassoziation und der EWR. Island könnte bei einem Beitritt auch die europäische Fischereipolitik beeinflussen ( UK ist ja weg…) und das wiederum gefällt Norwegen nicht, die sich dann verlassen in der EFTA/EWR wiederfinden würden.
Norwegen wird die EFTA nicht wegen der Schweiz an Leben erhalten
Der Politikredaktor Kjetil Alstadheim hat letzthin ein neues Buch zur EU-Politik von Norwegen publiziert. Der Titel ist vielsagend: Alle lagen falsch. Alstadheim glaubt, dass es Gründe gibt, „ungeduldig in der EU-Debatte“ zu sein. Er schreibt, von einer selbstverschuldete Außenseiterrolle und wie die norwegischen Ölmilliarden Norwegen in die „Erfolgsfalle“ geführt habe. Anstatt sich mit den Folgen einer sich dramatisch verändernden Welt auseinanderzusetzen, mache Norwegen einfach weiter, weil es ja gut laufe. Eine ähnliche Erfolgsfalle kennt die Schwiez mit ihrem Bilateralen Weg. Alstadheim spekuliert bereits über das Ende der EFTA und des EWR, wenn Island den Weg in die EU findet. Der EWR wäre wahrscheinlich bald Geschichte, denn ein EWR nur mit Norwegen und Liechtenstein ist eine sehr teure Sache. Wird man die EWR-Institutionen wegen zwei Ländern aufrecht erhalten?
Braucht die Schweiz vier Jahre für ein Referendum?
Mit den Diskussionsentwicklungen in den EFTA Staaten stellt sich somit die Frage, wann die Schweiz ihr Verhältnis mit den EU-Mitgliedsstaaten festigen soll. Ich meine: Vor dem isländischen Referendum ist ein solider Entscheid zum Stabiliisierungspaket in einer schweizerischen Referendumsabstimmung wichtiger denn je. Unsere EFTA Partner schauen seit Jahren, wie die Schweiz die europäische Zukunft gestalten will. Nur mit einem deutlichen Ja aus der Schweiz heraus kann die EFTA Zukunft vielleicht gefestigt werden. Denn die Schweiz vergisst immer, dass auch zwischen der EFTA und der EU vertragliche Bindungen bestehen. Wer in diesem Vertragswerk immer nur das Cherrypicking praktiziert, der verliert auch die Unterstützung der anderen EFTA-Partner. Norwegen, Island und Liechtenstein haben es etwas satt, den Sonderfall Schweiz weiter mitzunehmen. Wenn die Schweiz ihre Zögerlichkeit in der Beschlussfindung nicht ablegt, dann gibt es keinen Grund für Island und Norwegen auf die EFTA und den EWR zu setzen. Diese aussenwirtschaftpolitische Konsequenz wird in unserem Land aber noch zu wenig reflektiert. Der Bundesrat ist immer noch in einer Phase des Glückgefühls, dass er einen Verhandlungsabschluss geschafft hat. Aber Weiterdenken täte jetzt wirklich nötig.
Die europäische Situation verlangt das Schweizer Referendum im Herbst 2026
Dass die Schweiz ein klärendes Referendum nicht innert zwei Jahren nach dem Abschluss der Vertragspaket-Verhandlungen abhalten kann, ist eine Lachnummer. Nach 15 Jahren Verhandlungen mit der EU sind die Verträge auf dem Tisch. Der Bundesrat tut gut daran, dass er die Paraphierung und die Unterzeichnung mit Höchstgeschwindigkeit erledigt und die Botschaft an die Bundesversammlung überweist. Wer nicht im Herbst 2026 abstimmen möchte, will das Verhältnis Schweiz-EU nicht stabilisieren. Vor allem aber schwächt er auch die Partnerschaft mit unseren EFTA-Freunden Island, Norwegen und Liechtenstein. Es wäre die Ironie der Geschichte, wenn die europapolitische Zögerlichkeit der Schweiz auch noch das mögliche Ende unserer eigenständigen Freihandelspolitik in der EFTA einleiten würde. Das Marktvolumen der EFTA Staaten ist schon bescheiden, wenn die Schweiz zukünftig alleine ihre Freihandelspolitik voranbringen muss, dann wird sie nicht mehr in der ersten Reihe der erwünschten Verhandlungspartner stehen. Auch das wäre schlecht für unsere exportorientierte Wirtschaft. Die neue Zögerlichkeit des Bundesrates ist schlecht für unseren Standort.